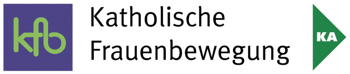Care: Gemeinsam für eine Zukunft miteinander füreinander

Sorgearbeit wird überwiegend von Frauen und meist un- oder unterbezahlt geleistet. Sie passiert vor allem im vermeintlich privaten Bereich: im Haushalt, in der Familie. Hier wird diese Arbeit oft nicht als Arbeit gesehen und bleibt damit nicht nur unbezahlt, sondern auch unsichtbar. Es sind daher verstärkt Frauen, die die Folgen tragen müssen, wenn öffentliche Leistungen in der Daseinsvorsorge gekürzt werden und Sorgearbeit immer mehr zur Privatsache wird.[1]
Durch die Verpflichtungen in der Sorgearbeit bleibt vielen Frauen auch gar keine Zeit für Erwerbsarbeit oder für Aus- und Fortbildung. Sie verfügen deshalb über weniger oder kein eigenes Einkommen. Auch die soziale Absicherung, wie Pensionen, Arbeitslosenversicherung oder ähnliches ist noch immer überwiegend an Erwerbstätigkeit gebunden. Um trotzdem eine finanzielle Absicherung sicherzustellen, müssen viele Sorgeleistende zusätzlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen, was zu einer Mehrbelastung führt. Was bedeutet das konkret? Fehlende soziale Absicherung, ein großer Arbeitsdruck und ökonomische Abhängigkeiten für den Großteil der Sorgetragenden. Die große Anzahl an Stunden, die unbezahlt gearbeitet werden, sind ein wichtiger Grund für den großen Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen.[2]
Die Herausforderungen der Sorgearbeit treffen Frauen überall auf der Welt und unterscheiden sich in ihren wesentlichen Fragestellungen kaum. Um ein gutes Leben für alle Menschen zu ermöglichen, muss daher diese Sorgekrise, die gleichermaßen eine Geschlechterkrise ist, gelöst und traditionelle Rollenbilder hinterfragt werden – miteinander und füreinander!
[1]Franziska Foissner 2021: Gemeinsam für eine Zukunft miteinander füreinander. Behelf zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, S. 3.
[2] Franziska Foissner 2021: Gemeinsam für eine Zukunft miteinander füreinander. Behelf zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, S. 5.